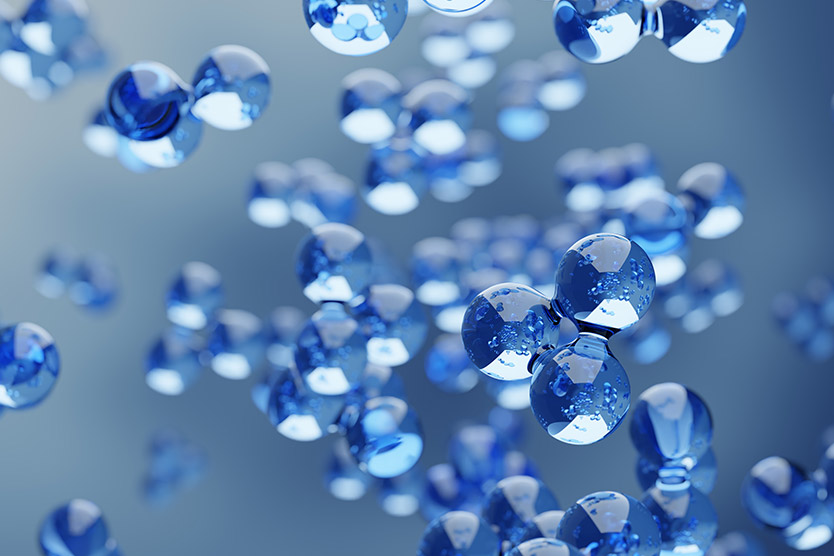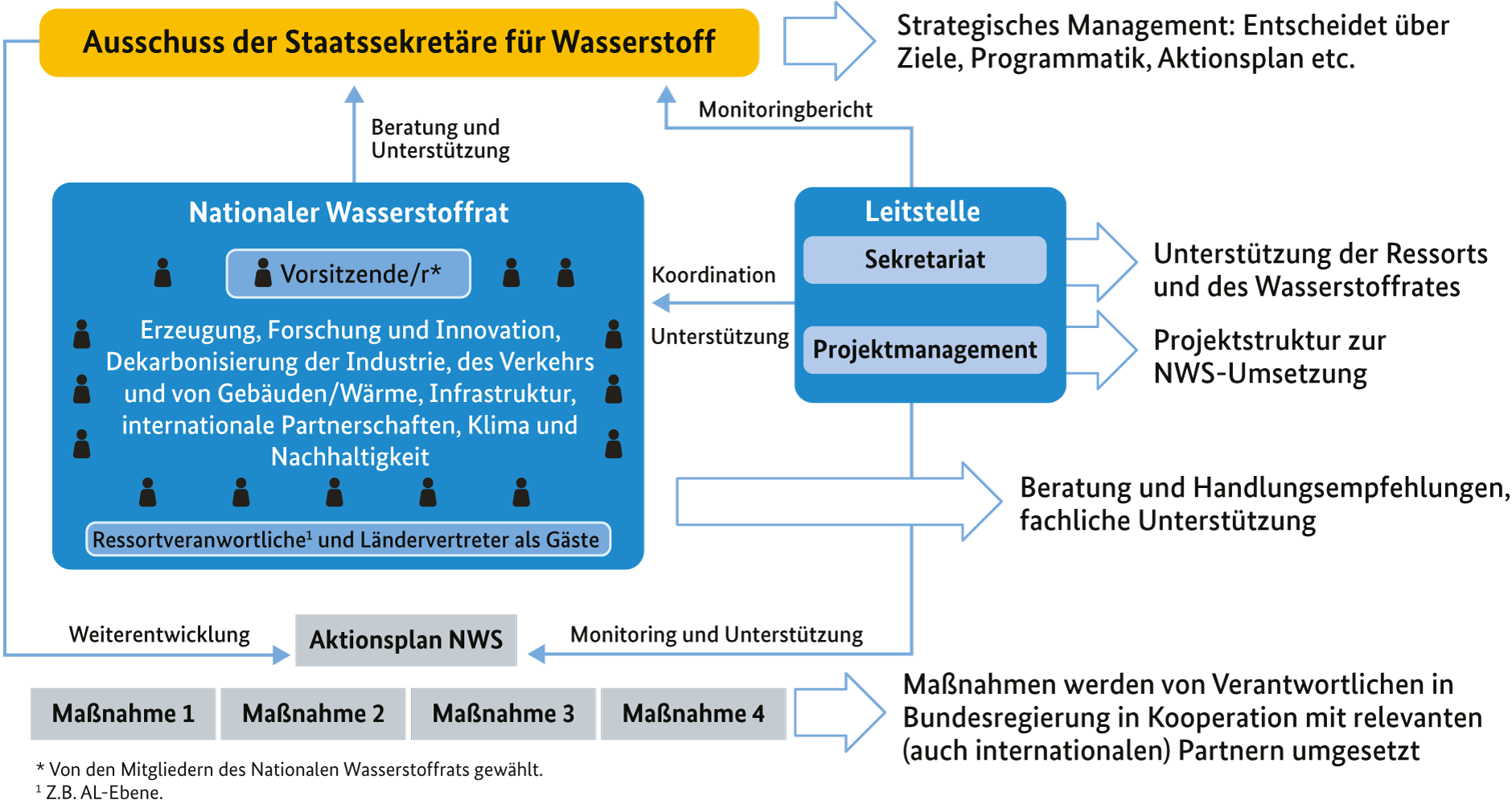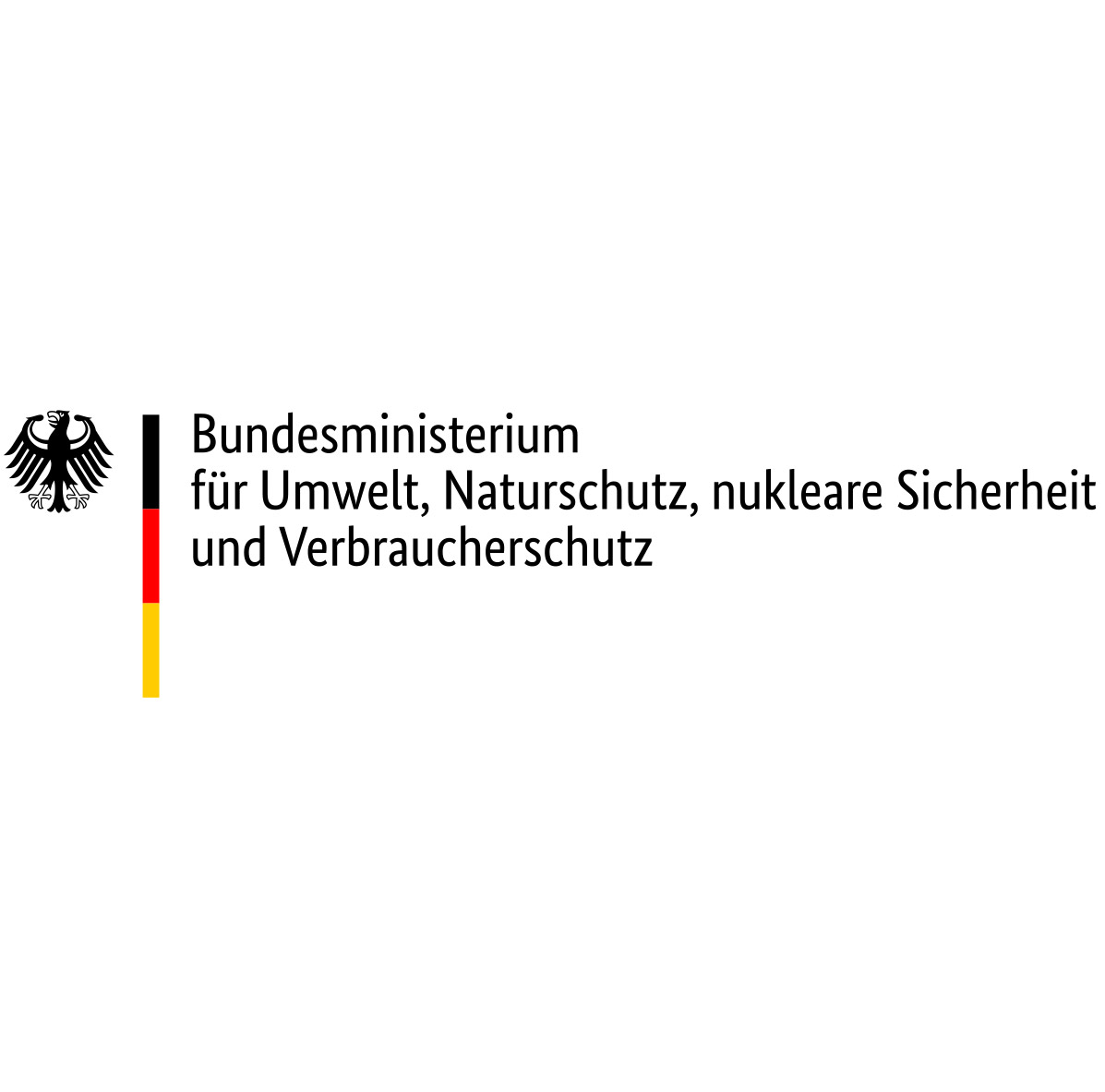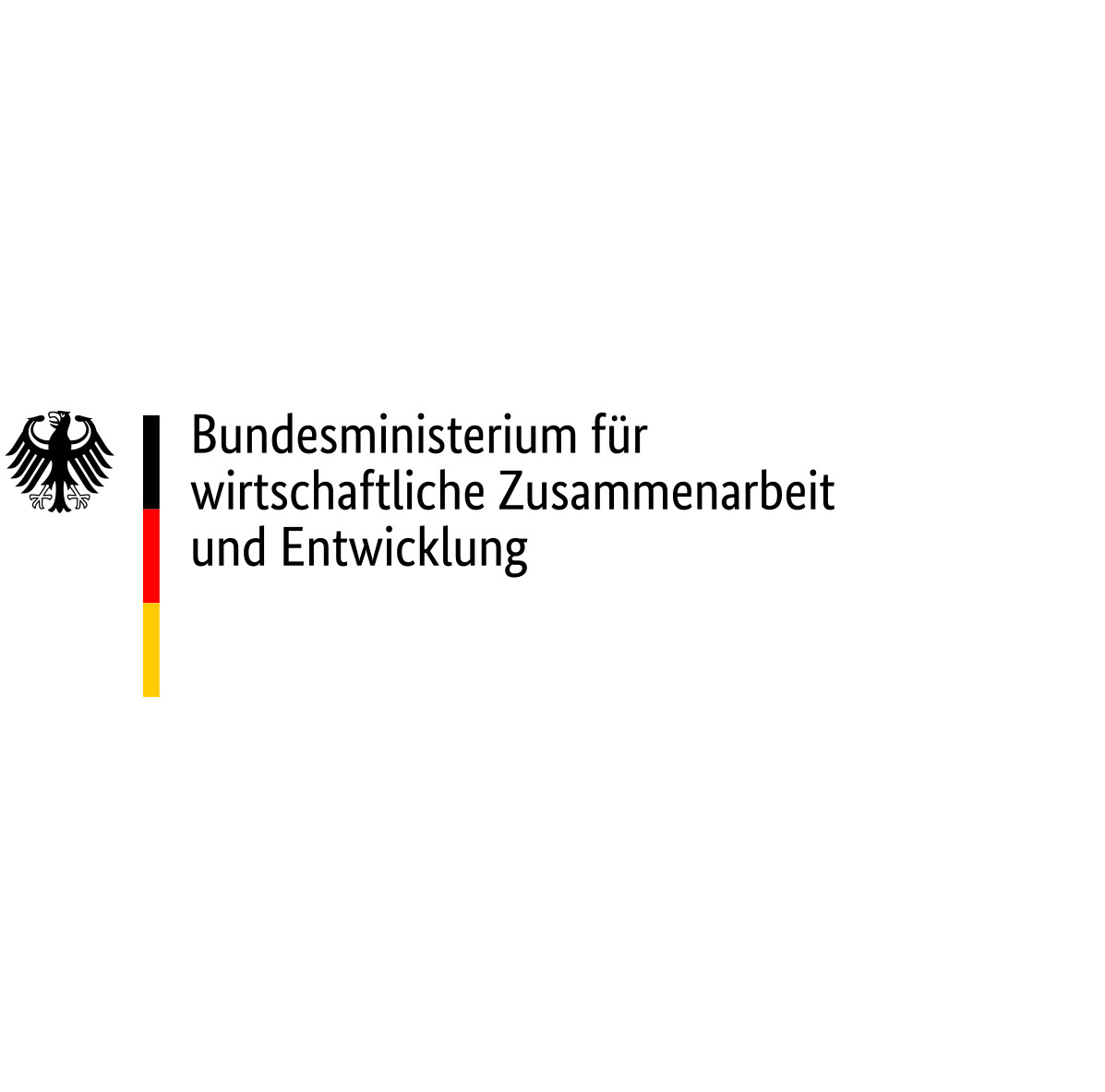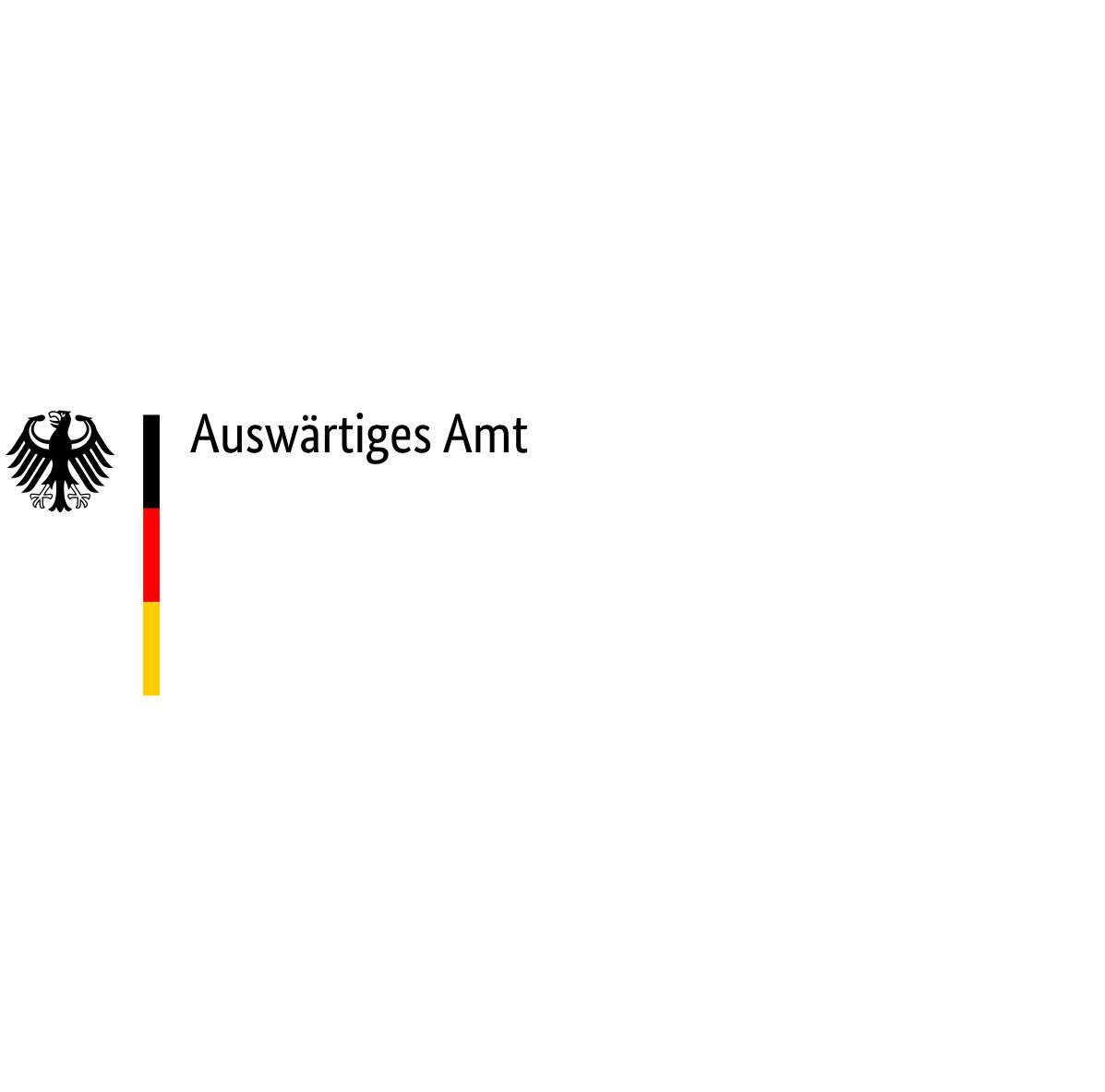Allerdings ist die Herstellung von Wasserstoff verhältnismäßig energieintensiv, weshalb er voraussichtlich in erster Linie dort eingesetzt werden sollte, wo eine direkte Nutzung erneuerbaren Stroms nicht möglich oder nicht wirtschaftlich ist. Zudem sind die Produktionskosten derzeit noch hoch und die Erzeugungskapazitäten nicht ausreichend. Daher sind hohe Investitionen in den Aufbau von Elektrolysekapazitäten, die Kompensation der höheren betrieblichen Produktionskosten sowie stabile Rahmenbedingungen für den wirtschaftlichen Absatz von Wasserstoff notwendig. Dies unterstützt die Bundesregierung im Rahmen der Nationalen Wasserstoffstrategie (NWS). Insgesamt sollen für die Förderung der Erzeugung, für den Aufbau der notwendigen Infrastruktur und die Nutzung von Wasserstoff mehrere Milliarden Euro aus Mitteln der Bundesregierung und der Länder zur Verfügung gestellt werden.
Wasserstofftechnologien sind nicht nur ein wichtiges Werkzeug für den Klimaschutz. Sie können neue Industriezweige mit vielen zukunftsfähigen Arbeitsplätzen und großen Exportchancen entstehen lassen. Viele deutsche Unternehmen, darunter auch Start-ups und mittelständische Unternehmen, haben bei Wasserstofftechnologien heute schon einen Platz in der internationalen Spitzengruppe, etwa bei Elektrolyseuren für die Herstellung von Wasserstoff und bei der Produktion von Brennstoffzellen, mit denen aus Wasserstoff Strom gewonnen wird. Die NWS soll somit auch dazu beitragen, dass der Industriestandort Deutschland seine starke Position bei Wasserstofftechnologien behält und weiter ausbaut.
Der im Mai 2022 veröffentlichte „Fortschrittsbericht zur Umsetzung der Nationalen Wasserstoffstrategie“ beleuchtet aktuelle Entwicklungen zur Regulatorik und stellt die Fortschritte bei der Umsetzung der NWS-Maßnahmen dar.