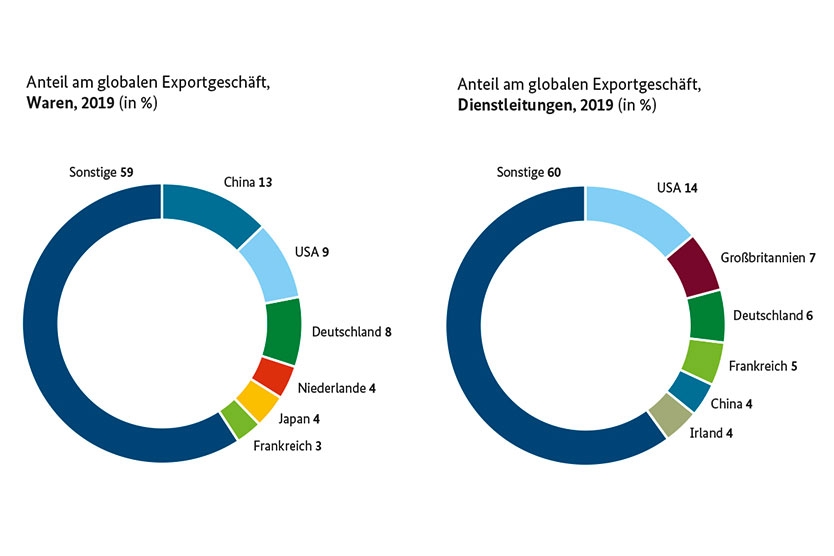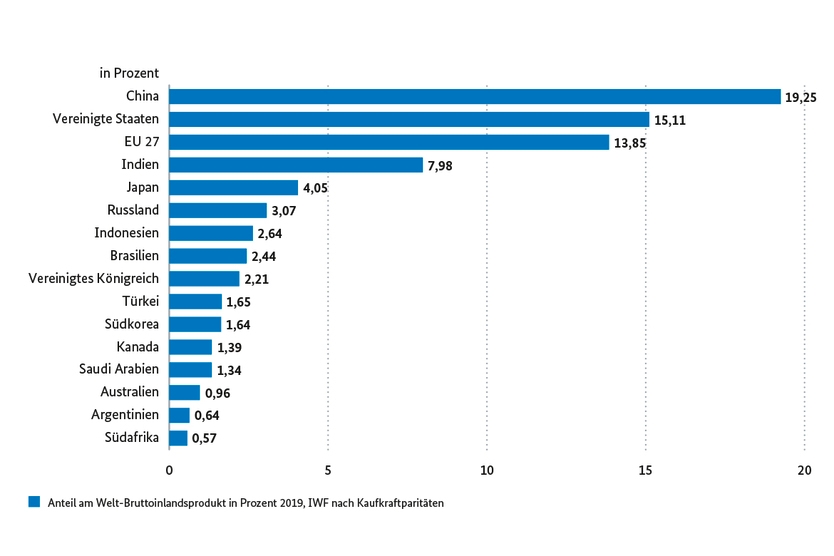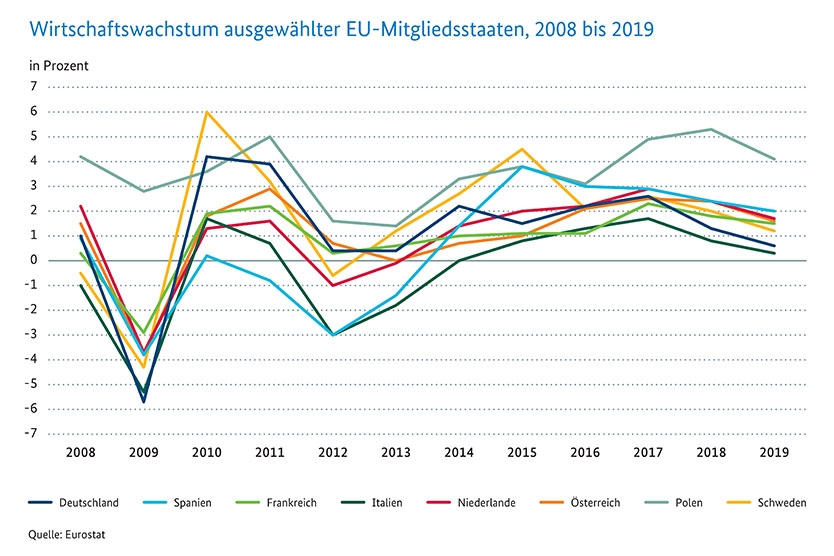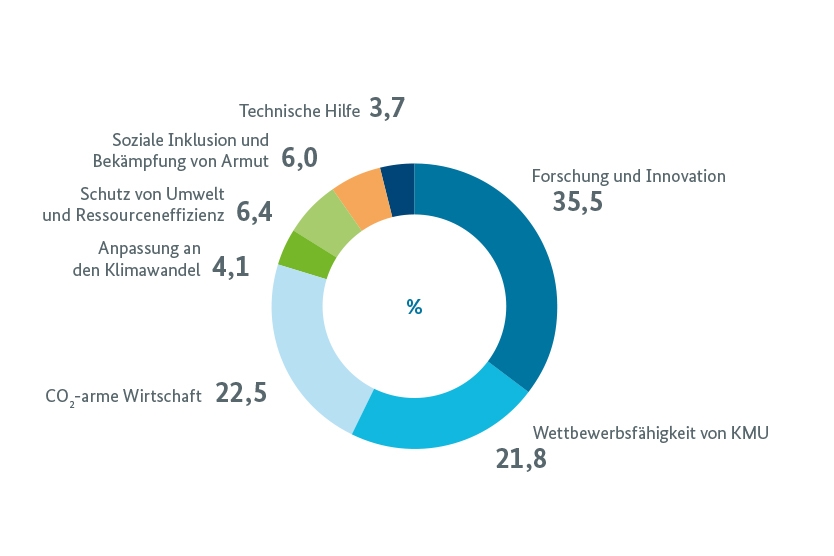Ein Raum „ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gemäß den Bestimmungen der Verträge gewährleistet ist“ – so wird der europäische Binnenmarkt in Artikel 26 Abs. 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) beschrieben.
Grenzüberschreitend reisen und arbeiten, Waren und Dienstleistungen einkaufen und anbieten
Der ungehinderte Warentransport über unsere Binnengrenzen ist heute ebenso unverzichtbar geworden wie das ungehinderte Reisen und Niederlassen für EU-Bürger innerhalb der Europäischen Union und weitgehend auch des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR), zu dem Island, Liechtenstein und Norwegen gehören. Aber der Weg dahin war weit und reicht bis in die Anfänge der Europäischen Integration zurück.
Am 25. März 1957 wurde mit der Unterzeichnung der Römischen Verträge durch Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, die Niederlande und die Bundesrepublik Deutschland die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) gegründet, um die gemeinsame Wirtschaftspolitik im Rahmen der europäischen Integration zu fördern – ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur heutigen Europäischen Union. Zum 60-jährigen Jubiläum der römischen Verträge hat das BMWi am 25. März 2017 die Broschüre „Perspektiven für ein wirtschaftlich starkes Europa“ veröffentlicht, die die Errungenschaften und aktuellen Handlungsfelder für die Europäische Union detailliert herausarbeitet. Die Broschüre ist hier abrufbar.
Mit dem "Weißbuch zur Vollendung des Binnenmarktes" der Europäischen Kommission von 1985 wurde dem Binnenmarkt neue Schubkraft verliehen und die Verwirklichung des Binnenmarktes bis 1992 beschlossen. Fast 30 Jahre nach der Verwirklichung des Binnenmarktes sind beachtliche Fortschritte zu verzeichnen. Die Einführung der gemeinsamen Währung, des Euro, lässt das Zusammenwachsen der Märkte zu einem einheitlichen europäischen Binnenmarkt auch nach außen erkennbar werden. Mehr erfahren.