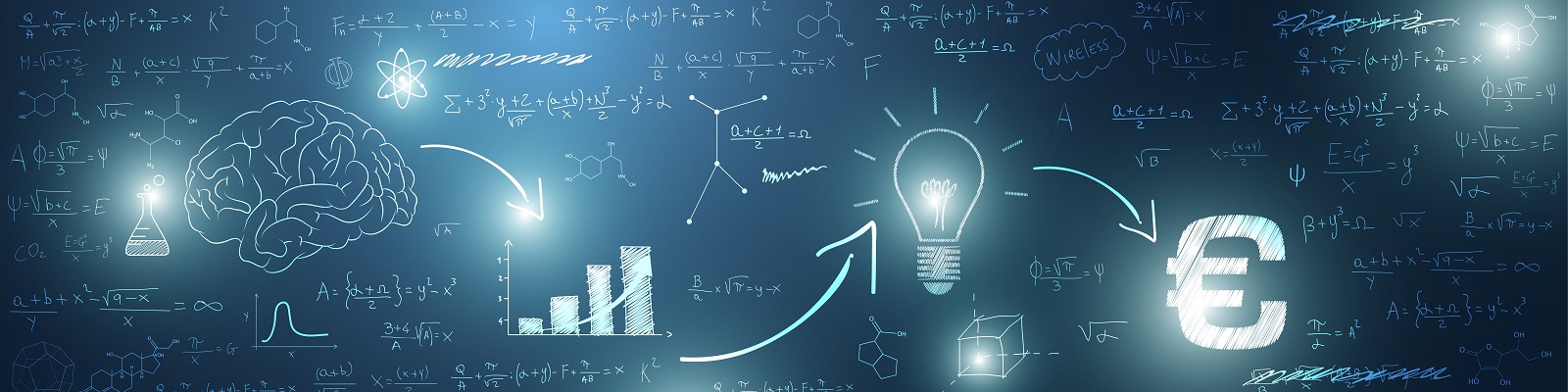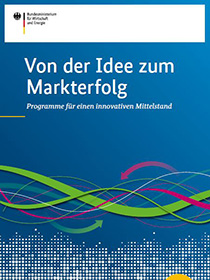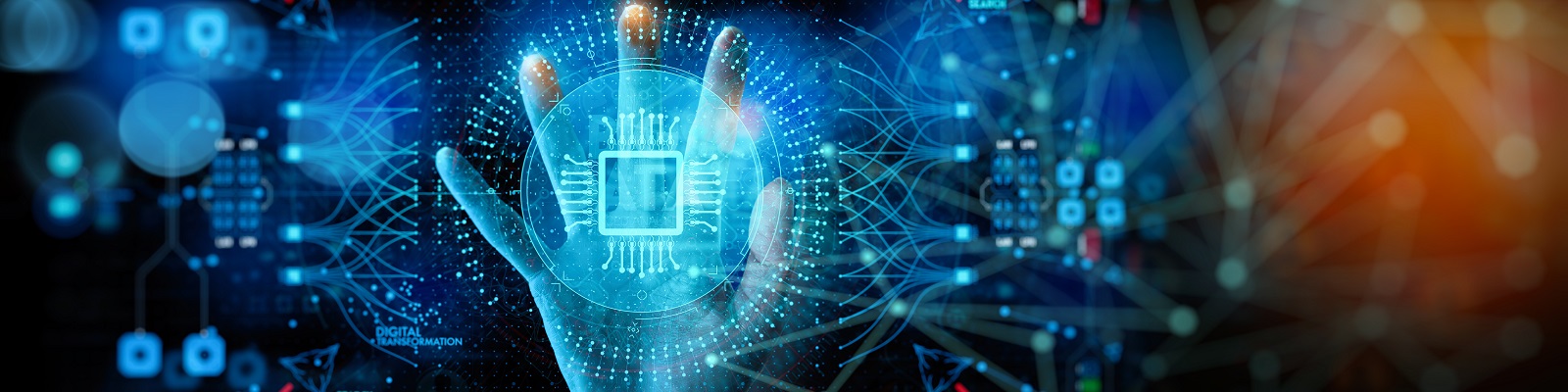Im Rahmen der Transferinitiative prüft das BMWK zusammen mit den Innovationsakteurinnen und -akteuren, was besser gemacht werden kann, damit der Transfer von Ideen in den Markt noch besser funktioniert. Dabei wird Bestehendes überprüft und Neues entwickelt. Ziel ist, das Innovationsökosystem zu optimieren, damit die Steigerung der Innovationstätigkeit in Deutschland gelingt.
Transfer als dritte Mission der Hochschulen, November 2023 in Berlin
Der gelingende Wissenstransfer von Forschungsergebnissen in die Wirtschaft ist ein zentrales Anliegen der Innovationspolitik des BMWK, um die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft heute und in Zukunft sicherzustellen.
Im Rahmen des am 16. November 2023 durchgeführten Workshops „Transfer als dritte Mission der Hochschulen“ wurden die Perspektiven von Hochschulen und Unternehmen zu Erfolgsfaktoren des Wissens- und Technologietransfers zusammengeführt. Als dritte Mission der Hochschulen versteht man die Wahrnehmung der Aufgabe des Transfers neben den althergebrachten Aufgaben Forschung und Lehre. In den vergangenen Jahren hat sich die Umsetzung dieser Mission deutlich ausgebaut und sich in der Einrichtung von hochschulnahen Transferstellen niedergeschlagen.
Welche Faktoren für das Gelingen einer Transferstelle besonders wichtig sind, illustrierte Volker Hofmann mit Erfahrungen der Humboldt-Innovation, der hochschuleigenen Transferstelle der Humboldt Universität zu Berlin. Herr Hofmann betonte die Bedeutung der rechtlichen Eigenständigkeit der Transferstellen als Unternehmen. Durch die eigene Geschäftstätigkeit würden diese zu „natürlichen Partnern“ für die Unternehmen und könnten einfacher unternehmerische Risiken eingehen als Körperschaften des öffentlichen Rechts. Darüber hinaus könnten durch ein sukzessive aufgebautes ganzheitliches Verständnis der Innovations- und Gründungsphasen effiziente Strukturen und optimierte Prozesse implementiert werden. Bei der Umsetzung helfen strategische Klarheit und eine hohe Prozessgeschwindigkeit. Herr Hofmann hob auch die Bedeutung von Alumni der Hochschulen als „Transferagenten“ hervor.
Im folgenden Podium besetzt durch Herrn Hofmann, Frau Kaiser-Steiner (UnternehmerTUM), und Frau Dr. Brönstrup (BMWK) wurde die Bedeutung von „Role Models“ für Ausgründungen diskutiert, auch um die Gründungsbereitschaft in Zeiten des Fachkräftemangels mit attraktiven konkurrierenden Karriereoptionen hoch zu halten. Dieses könne auch durch die Verankerung von Entrepreneurship im Studium gelingen, so Kaiser-Steiner. Des Weiteren wurde die Bedeutung der Erleichterung der Nutzung des geistigen Eigentums der Hochschulen für den Ausgründungsprozess festgehalten.
Zusammen mit den Workshop-Teilnehmenden wurde anschließend die Innovationskultur von Unternehmen als ein Element ihrer Aufnahmefähigkeit von Innovationen aus der Wissenschaft identifiziert. Ebenso wurde die Bedeutung der Vereinfachung des Matchmakings zwischen Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen hervorgehoben.
Aus den Impulsvorträgen, den Parallelworkshops und den Podiumsdiskussionen, die das Thema „Transfer als dritte Mission der Hochschulen“ sowohl aus der Perspektive der Hochschulen als auch der Unternehmen beleuchtet haben, lassen sich zusammenfassend folgende Erkenntnisse ziehen:
These 1: Damit der Transfer von der Forschung in die Industrie gelingen kann, sind Kultur und Struktur von entscheidender Bedeutung: Es braucht das richtige Mindset, eine gemeinsame Sprache („Übersetzer“) auf der einen und die richtigen organisatorischen Rahmenbedingungen für das Auf-den-Weg-Bringen wie auch die unternehmerische Umsetzung von Forschungsergebnissen auf der anderen Seite. Eine große Herausforderung liegt darin, passende Partner zu finden. Mögliche Lösungsansätze sind überregionale Datenbanken zu aktiven Forschungsgruppen und Themen sowie regionale Vernetzung.
These 2: Transfer als dritte Mission sollte Hochschulen strategisch, operativ und ideell durchdringen. Transferaktivitäten sollten zentral organisiert sein, definierte Prozesse haben und kontinuierlich verlaufen – im besten Fall in Form eines unternehmerischen Vehikels, das rechtlich unabhängig von der jeweiligen Hochschule agieren kann. In den Hochschulen wird dauerhaft finanziertes Personal benötigt, das sämtliche Transferaktivitäten unterschiedlicher Fakultäten und Fachbereiche kennt und bei Bedarf Austausch organisiert. Durch Formate wie Transferpreise oder Transferdays und gezielte Kommunikation werden bessere Sichtbarkeit und höhere Wertschätzung des Themas erreicht.
These 3: Mittelständische Unternehmen sind als Partner und potenzielle erste Kunden für ausgegründete Start-ups besonders wertvoll. Indem innovative öffentliche Beschaffung ausgebaut wird, könnte der Staat ebenfalls als erster Kunde auftreten und Start-ups unterstützen.
These 4: Fördermaßnahmen sollten weiterhin in die Breite ausgerichtet sein, während die Frage nach Skalierungschancen durch den Markt beantwortet wird. Gleichwohl ist die Finanzierung für viele Start-ups aufgrund der risikoaversen Investitionskultur schwierig.
These 5: Damit Unternehmen, insbesondere Start-ups und KMU, in der Lage sind, Wissen, Kompetenzen und neue Technologien aus der Forschung in ihre betriebliche Praxis zu übernehmen, müssen sowohl unternehmerischer Wille als auch ausreichende personelle Kapazitäten vorhanden sein. Wissens- und Technologietransfer in die Industrie kann nur erfolgen, wenn Unternehmerinnen und Unternehmer über das Tagesgeschäft hinaus Neues anstoßen wollen – und können.