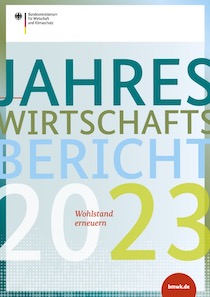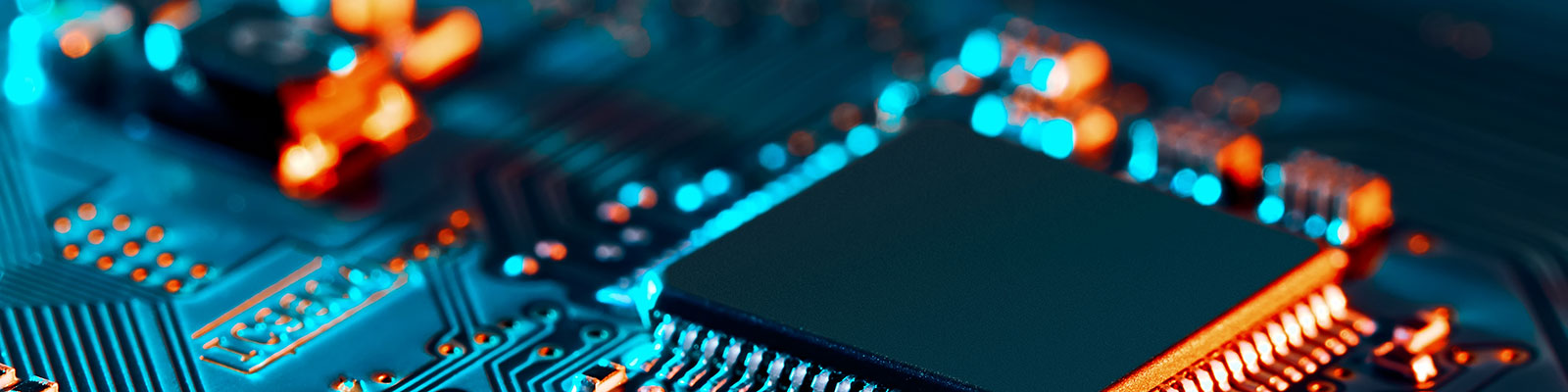| „Das, was den Erfolg bringt, die große Krise unserer Zeit zu bewerkstelligen, kleiner zu machen bzw. zu überwinden, das wird belohnt werden müssen an den Märkten und entsprechend der Wandel von der sozialen zur ökologisch-sozialen Marktwirtschaft, die externalisierten Kosten nicht als heimliche Gewinne in den Unternehmen zu lassen, sondern durch Regeln oder Bepreisung dafür zu sorgen, dass sich die ganze Kreativität des Marktes dem Ziel der Klimaneutralität richtet und so wir Prosperität, Reichtum, Wohlstand mit dem Schutz der planetaren Grenzen verbinden können. Wenn wir das schaffen, werden wir gemeinsam Geschichte schreiben.“ – Robert Habeck |
Die Wirtschaftspolitik muss die Herausforderungen dieser Zeit angehen und den Wohlstand nachhaltig bewahren und erneuern. Wie zu den Anfangszeiten der Sozialen Marktwirtschaft sind auch heute Unternehmertum und Gründergeist gefragt. Um die notwendigen Freiräume auch und gerade für die erforderlichen Veränderungen zu schaffen gilt es, Umfang und Komplexität von Bürokratie zu reduzieren – sowohl für die Unternehmen als auch im Sinne eines agilen und handlungsfähigen Staats. Technologischer Fortschritt und Innovationen sind grundlegende Voraussetzungen für Produktivitätswachstum. Deshalb müssen Forschung und Entwicklung gestärkt und zugleich an den gesamtgesellschaftlichen Erfordernissen ausgerichtet werden. Außerdem gilt es gerade in Zeiten des demografischen Wandels und multipler Herausforderungen, die Leistungsbereitschaft zu stärken und für eine gerechte Teilhabe am Wohlstand zu sorgen.
Das Leitbild der Sozial-ökologischen Marktwirtschaft verlangt eine klare Zukunftsorientierung. Unsere Wirtschaftsordnung muss die Interessen künftiger Generationen wahren. Dazu sind neben einer Begrenzung der öffentlichen Verschuldung zugleich hinreichende Investitionen in Bildung und die öffentliche Infrastruktur erforderlich. Dabei gilt es, den Schutz essenzieller Umweltgüter systematischer und verlässlicher zu berücksichtigen. Dies erfordert zunächst eine breitere und auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Erfassung von Wohlfahrt und Fortschritt. Eine effektive und außerdem sozial akzeptierte Klimaschutzpolitik erfordert einen effizienten Maßnahmenmix, in dessen Zentrum – nicht zuletzt durch die Ausweitung des Europäischen Emissionshandels – künftig marktwirtschaftliche Instrumente stehen. Das Modell der Sozial-ökologischen Marktwirtschaft ist damit der zentrale konzeptionelle Überbau für die Transformation hin zur Klimaneutralität: Es ist das notwendige „Update“ der seit 75 Jahren bewährten Sozialen Marktwirtschaft.
Im Jahreswirtschaftsbericht, den das Bundeswirtschaftsministerium jedes Jahr federführend erstellt, berichtet die Bundesregierung über ihre aktuellen wirtschaftspolitischen Prioritäten. Dieser enthält seit einigen Jahren auch ein Kapitel mit Punkten zu einer erweiterten Wohlfahrtsberichterstattung, um den Blick auf Wachstum und Fortschritt jenseits der klassischen Indikatoren zu weiten. Jeden Monat gibt das Bundeswirtschaftsministerium zudem einen Überblick über aktuelle Themen der Wirtschaftspolitik.