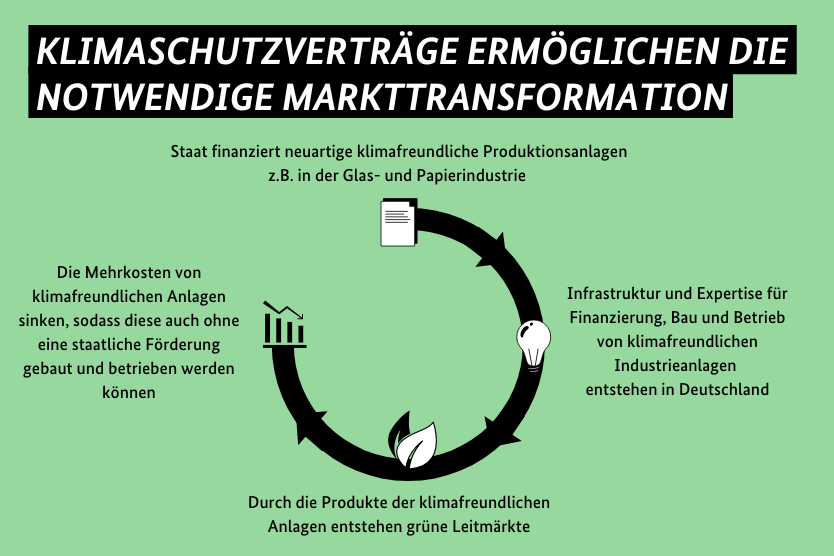Einwilligung in Tracking und / oder Videodienste
Wir bitten Sie an dieser Stelle um Ihre Einwilligung für verschiedene Zusatzdienste unserer Webseite: Wir möchten die Nutzeraktivität mit Hilfe datenschutzfreundlicher Statistiken verstehen, um unsere Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern. Zusätzlich können Sie in die Nutzung zweier Videodienste einwilligen. Nähere Informationen zu allen Diensten finden Sie, wenn Sie die Pluszeichen rechts aufklappen. Sie können Ihre Einwilligungen jederzeit erteilen oder für die Zukunft widerrufen. Rufen Sie dazu bitte diese Einwilligungsverwaltung über den Link am Ende der Seite erneut auf.
Diese Webseite setzt temporäre Session Cookies. Diese sind technisch notwendig und deshalb nicht abwählbar. Sie dienen ausschließlich dazu, Ihnen die Nutzung der Webseite zu ermöglichen.
Unsere Datenerhebung zu statistischen Zwecken funktioniert so: Ihre Zustimmung vorausgesetzt, leitet ein Skript auf unserer Webseite automatisch Ihre IP-Adresse und den sog. User Agent an die etracker GmbH weiter. Hier wird Ihre IP-Adresse unmittelbar und automatisch gekürzt. Anschließend pseudonymisiert die Software die übermittelten Daten ausschließlich zu dem Zweck, Mehrfachnutzungen in der Sitzung feststellen zu können. Nach Ablauf von 7 Tagen wird jede Zuordnung zur Sitzung gelöscht, und Ihre statistischen Daten liegen gänzlich anonymisiert vor. Etracker ist ein deutsches Unternehmen, und verarbeitet Ihre Daten ausschließlich in unserem Auftrag auf geschützten Servern. An weitere Dritte werden sie nicht übermittelt. Verantwortlich für diese Verarbeitung Ihrer Daten ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Unsere Datenschutzbeauftragte erreichen Sie unter datenschutzbeauftragte@bmwk.bund.de. Als Rechtsgrundlage dient uns Ihre Einwilligung nach § 25 Abs. 1 TTDSG i. V. m. Artikel 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO und § 3 Abs. 1 EGovG. Wir haben sichergestellt, dass Sie Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen können. Rufen Sie dazu bitte diese Einwilligungsverwaltung über den Link am Ende der Seite erneut auf.
Das Ministerium präsentiert seine Arbeit auf dieser Webseite auch in Form von Videos. Diese werden vom deutschen Anbieter TV1 mit Hilfe des JW-Players mit Sitz in den USA ausgeliefert. Bitte willigen Sie in die Übertragung Ihrer IP-Adresse und anderer technischer Daten an den JW-Player ein, und erlauben Sie JW-Player, Cookies auf Ihrem Endgerät zu setzen, wenn Sie unser Video-Angebot nutzen wollen. Verantwortlich für diese Verarbeitung Ihrer Daten ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Unsere Datenschutzbeauftragte erreichen Sie unter datenschutzbeauftragte@bmwk.bund.de. Als Rechtsgrundlage dient uns Ihre Einwilligung nach § 25 Abs. 1 TTDSG i. V. m. Artikel 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO und § 3 Abs. 1 EGovG. Wir haben sichergestellt, dass Sie Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen können. Über die Einwilligungsverwaltung am Ende der Seite können Sie jederzeit steuern, ob Sie den Videodienst JW-Player zur Übertragung freigeben oder nicht.
Die Live-Übertragung von Pressekonferenzen des Ministeriums erfolgt über die Infrastruktur des amerikanischen Dienstleisters Vimeo.com. Bitte willigen Sie in die Übertragung Ihrer IP-Adresse und anderer technischer Daten an Vimeo ein, und erlauben Sie Vimeo, Cookies auf Ihrem Endgerät zu setzen, wenn Sie unseren Livestream-Videodienst nutzen wollen. Verantwortlich für diese Verarbeitung Ihrer Daten ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Unsere Datenschutzbeauftragte erreichen Sie unter datenschutzbeauftragte@bmwk.bund.de. Als Rechtsgrundlage dient uns Ihre Einwilligung nach § 25 Abs. 1 TTDSG i. V. m. Artikel 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO und § 3 Abs. 1 EGovG. Wir haben sichergestellt, dass Sie Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen können. Über die Einwilligungsverwaltung am Ende der Seite können Sie steuern, ob Sie den Videodienst Vimeo zur Live-Übertragung freigeben wird oder nicht.
Ausführliche Informationen über Ihre Betroffenenrechte und darüber, wie wir Ihre Privatsphäre schützen, entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.