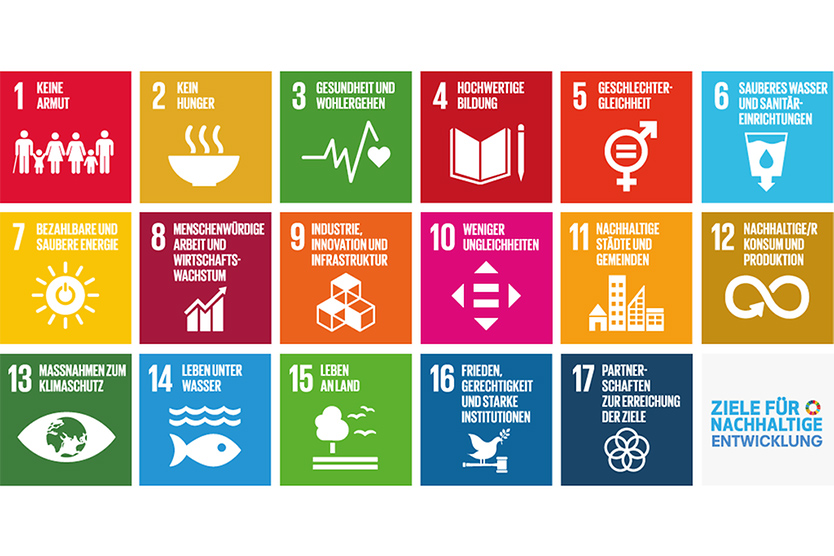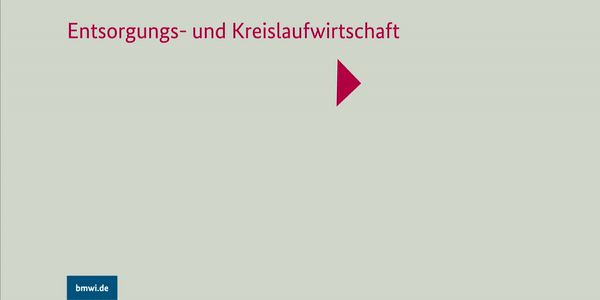Die Industrie ist aufgrund der besonderen Bedeutung für die deutsche Wirtschaft maßgeblich gefordert, den globalen Herausforderungen wie zum Beispiel dem Klimaschutz zu begegnen. Das BMWK unterstützt die industriellen Branchen dabei, sich an diese Herausforderungen anzupassen. Ein Beispiel hierfür ist das „Handlungskonzept Stahl“. Ziel dieser Initiative ist es, eine langfristig starke, international wettbewerbsfähige und klimaneutrale Stahlproduktion am Standort Deutschland zu erreichen.
Der Klimaschutz erfordert den Umstieg auf eine emissionsfreie Mobilität. Daher steht auch die Fahrzeugindustrie vor einem großen Umbruch, den sie mit Hilfe von Innovationen meistern muss und hierin wird sie von der Bundesregierung mit zahlreichen Förderprogrammen unterstützt. Die Förderung des Ausbaus der Ladesäuleninfrastruktur schafft die Voraussetzung für eine erfolgreiche Elektromobilität. Das BMWK engagiert sich gleichermaßen im Seeverkehr für die Einführung klimafreundlicher Kraftstoffe als auch in der Luftfahrt für die Entwicklung klimaneutraler Konzepte für Antriebstechnologien um künftige Emissionsanforderungen der Luftfahrt zu erfüllen.
Um die Nachhaltigkeit von Elektrofahrzeugen weiter zu steigern ist es essentiell, die Herstellungs- und Entsorgungsbedingungen von Batterien zu optimieren. Daher ist die Steigerung der Batterie-Nachhaltigkeit ein zentrales Ziel der beiden „Important Projects of Common European Interest“ (IPCEIs) im Bereich Batteriezellfertigung, von denen eines vom BMWK koordiniert wird. Dabei stehen gleichermaßen der ökologische Fußabdruck der Batterie-Wertschöpfungskette wie auch die Nachnutzung und das Recycling von Batterien im Fokus.
Mit Blick auf die nachhaltige Entwicklung von Städten und Kommunen ist die Entwicklung des Einzelhandels zentral. Er befindet sich durch den demografischen Wandel, geändertes Verbraucherverhalten, technologische Neuerungen und Digitalisierung in einem Strukturwandel. Um in diesem Strukturwandel neue Perspektiven aufzuzeigen, hat das BMWK Maßnahmen entwickelt, um einer Verödung der Innenstädte und einer Unterversorgung im ländlichen Raum entgegenzuwirken.
Eine Schlüsseltechnologie, die Innovationen in vielen Industriebereichen vorantreibt, einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klima- und Nachhaltigkeitsziele leistet und gleichzeitig die Innovationskraft des Wirtschaftsstandorts Deutschland stärkt, ist der Leichtbau. Vor allem für den nachhaltigen Umbau des Mobilitätssektors und für den Ausbau der erneuerbaren Energien sind Leichtbautechnologien entscheidend. Die Leichtbaustrategie soll dabei unterstützen die gute Position Deutschlands beim Leichtbau weiter auszubauen. Daher unterstützt das BMWK den Leichtbau seit 2017 mit der Initiative Leichtbau.
Rohstoffe bilden die elementare Grundlage für die industrielle Wertschöpfung in Deutschland und Europa. Eine sichere Rohstoffversorgung ist grundlegend für den Technologiestandort Deutschland. Damit geht auch die Verantwortung einher, sich für eine nachhaltige und sozial verträgliche Gewinnung sowie schonende Nutzung von Rohstoffen einzusetzen. Ereignisse mit geopolitischen Auswirkungen wie die Corona-Pandemie und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine haben sowohl die Abhängigkeit von globalen Lieferketten als auch die Risiken für die Rohstoffversorgungssicherheit der Industrie in der EU noch einmal sehr verdeutlicht. Um Unternehmen bei der Sicherung einer nachhaltigen und langfristigen Rohstoffversorgung stärker zu unterstützen, hat das BMWK im Januar 2023 Eckpunkte „Wege zu einer nachhaltigen und resilienten Rohstoffversorgung“ vorgelegt, mit denen die von der Bundesregierung im Januar 2020 beschlossene Rohstoffstrategie der Bundesregierung fortgeschrieben und weiter konkretisiert wird.